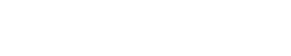Offener Brief an Norbert Lammert
Lieber Bruder Norbert,
ich nehme mir die Freiheit, den Präsidenten des Deutschen Bundestages zu duzen; nicht an ihn nämlich ist dieser Brief gerichtet, sondern an den „engagierten katholischen Christen“, der gerade eine Kampagne für die Zulassung katholischer verheirateter Männer zur Priesterweihe gestartet hat. Ich schreibe Dir, weil ich derselben Kirche angehöre, und ich schreibe Dir öffentlich, weil auch Du den öffentlichen Weg gewählt hast, um an die deutschen Bischöfe eine „Bitte“ heran zu tragen: Sie mögen sich „vor allem in Rom mit Nachdruck“ dafür einsetzen, dass „viri probati“ Priester werden dürfen.
Du, lieber Bruder Norbert, schreibst, Du seiest ebenso wie Deine Mitstreiter aus der CDU getrieben von „lebenslanger kirchlicher Verbundenheit, tiefer Sorge und wachsender Ungeduld“. Dass letztere nicht eben ein starkes Motiv ist – auch ich bin zum Beispiel wachsend ungeduldig, wann es endlich einen ausgeglichenen Staatshaushalt geben wird –, kannst Du mir gewiss zugestehen. Ungeduld ist eine Temperatur des Inneren, die sich auf törichte ebenso wie edle Ziele richten kann. Persönliche Ungeduld ist manchmal nahe am Trotz und somit an der Unreife und also ganz gewiss in diesem weltkirchlich brisanten Konflikt nicht maßgebend.
Tiefe Sorge treibe Dich um, lese ich. Worüber bist Du tief besorgt? Über die „besorgniserregende Zunahme des Priestermangels“ in Deutschland, über die „Not vieler priesterloser Gemeinden“, aus der ein „seelsorgerischer Notstand“ resultiere. Du verweist darauf, dass die Zahl der „Geistlichen in der Pfarrseelsorge“ seit 1960 in Deutschland von 15.500 auf 8500 zurückgegangen sei, also um 45 Prozent.
Du sagst nicht, dass in derselben Zeit der Anteil der sonntäglichen Gottesdienstbesucher unter den Katholiken von 46 auf 13 Prozent kollabierte, also um 70 Prozent einbrach. Der Rückgang an praktizierenden Katholiken war also wesentlich stärker als der Rückgang an Priestern. Sollte uns das nicht stärker umtreiben? Ist die Verdunstung des Glaubens nicht der dramatischere Befund als die wachsende Entfernung zwischen den Stätten sonntäglicher Eucharistiefeier?
Das nämlich, lieber Norbert, scheint Dich vor allem zu beschweren: Dass Gläubigen, die das „Recht auf die sonntägliche Messfeier“ wahrnehmen wollen, dieser Wunsch oft „unverhältnismäßig erschwert“ werde. Von der Sonntagspflicht sprichst Du nicht, aber von den erschwerten Bedingungen, sonntags zur Messe zu gelangen.
Verhältnismäßigkeit ist ein Begriff aus der Jurisprudenz. Er meint die Angemessenheit staatlichen Verhaltens gegenüber dem einzelnen Staatsbürger und ist also in einer theologischen Erörterung fehl am Platz. Ist es in Zeiten fast maximaler Mobilität „unverhältnismäßig“, fünf oder zehn oder mehr Kilometer zurückzulegen? Ist es „unverhältnismäßig“, vielleicht gemeinsam sich aufzumachen zum Höhepunkt kirchlichen Lebens, zur Feier von Wochenanfang und Auferstehung, zur persönlichen Begegnung mit dem Herrn der Geschichte und des Kosmos, dem Erlöser? Sind Christen Menschen, die nur zu „verhältnismäßigen“ Einschränkungen ihrer Bequemlichkeit bereit sind, nicht aber zur Liebestat, die auch opfernd sich verschenkt? Das Kriterium der Verhältnismäßigkeit hilft uns nicht weiter.
Im Ganzen, lieber Norbert, argumentierst Du soziologisch und ergo quantitativ und strikt säkular. Darf eine Kirche, die Kirche sein will und der Du Dich lebenslang verbunden fühlst, sich solchen Argumenten öffnen? Du erwähnst eine Umfrage, der zufolge 87 Prozent der Deutschen das „Eheverbot für das Priesteramt“ für „nicht mehr zeitgemäß“ halten. War Jesus zeitgemäß? Hätte man vor 2000 Jahren eine Umfrage im Heiligen Land gemacht, wofür die Menschen ihn hielten und ob man seiner Botschaft folgen solle, hätten gewiss mehr als 87 Prozent ihn außer Landes gewünscht, den „Störenfried“. Und war das „zeitgemäße“ Christentum nicht zu allen Zeiten ein von Christus möglichst weit entferntes Christentum, das mit der Macht kungelte, mit dem Staat, mit Kaiser, Zar und Führer?
Außerdem verblüfft mich, lieber Norbert, der leicht anmaßende Ton, mit dem Du den „seelsorgerischen Notstand“ allein an der hie und da ausgedünnten Zahl der Eucharistiefeiern meinst festmachen zu können. Sind wirklich nur geweihte Priester Seelsorger? Bist Du noch nie Diakonen begegnet, wie es sie gottlob reichlich gibt? Traust Du keinem anderen gemeindlichen Mitarbeiter zu, seelsorgerisch zu wirken, als nur dem Priester?
Schließlich hat mir noch niemand – auch Du nicht, lieber Norbert – die Frage beantwortet, warum es in jenen evangelischen, altkatholischen oder sonstigen christlichen Gemeinschaften, die den Zölibat nicht kennen, keineswegs boomt, sondern der Glaube noch weit rascher sich verzieht. Auch um den Nachwuchs steht es dort keineswegs leuchtend bestellt.
Katholische Priester folgen Christus auch insofern nach, als sie dessen Ehelosigkeit sich zur eigenen Lebensform erwählen. Sie setzen dadurch, im Unterschied etwa zu Politikern, die sich qua Pressekonferenz selbst zum Privatier erklären können, radikal und mit Haut und mit Haar und ganz freiwillig lebenslang auf diesen Christus. Manchmal denke ich, der Zölibat wird nur deshalb von nicht-zölibatär lebenden Menschen angegriffen, weil sie es nicht ertragen, dass es in unserer Gesellschaft Menschen gibt, die leibhaft beweisen, dass es auch im 21. Jahrhundert lebenslange Treue, lebenslange Eindeutigkeit geben kann. Jeder katholische Priester ist ein wandelnder Einspruch gegen die Allmacht der Diesseitigkeit.
Du, lieber Norbert, trägst nun leider dazu bei, diesen Einspruch um Christi Willen herabzusetzen, aus persönlicher Ungeduld und in soziologischer Perspektive. So aber relativierst Du Christus selbst. Darum habe ich Dir geschrieben.
In brüderlicher Verbundenheit,
Alexander Kissler.