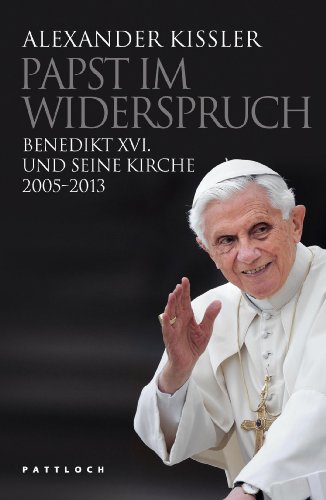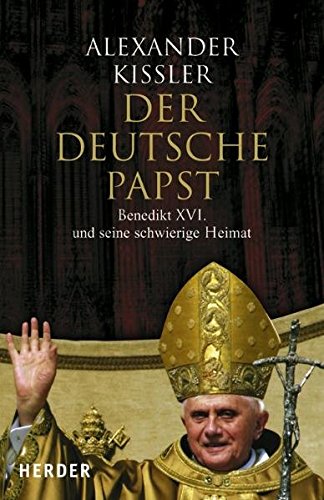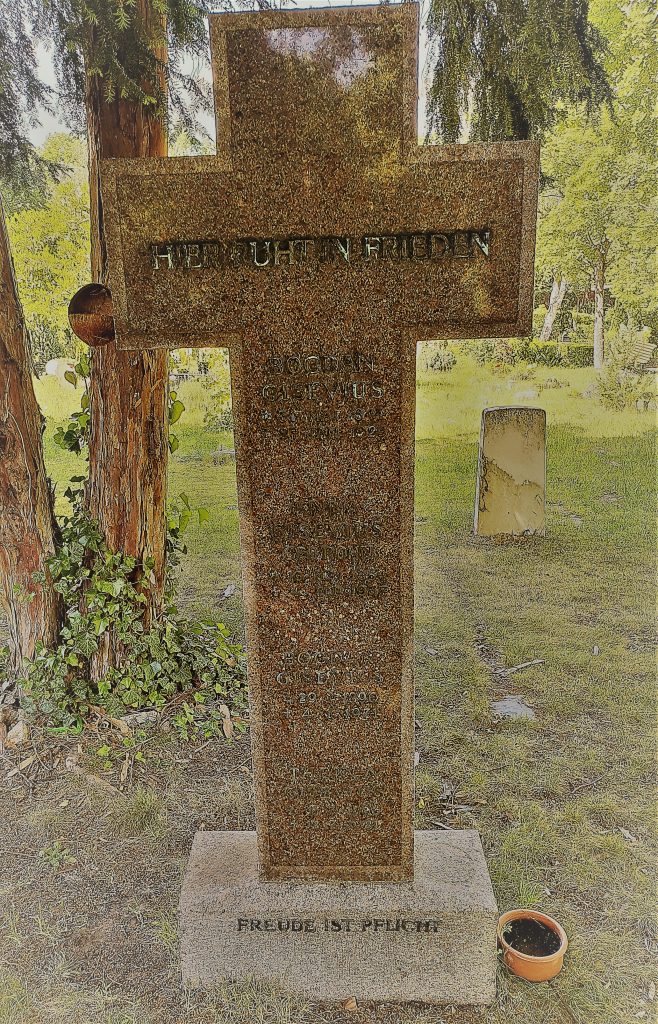Weihnachten ist ein Skandal

„Verkündigung des Engels an die Hirten auf dem Feld“ wirbt die Post.
Größer könnten die Unterscheide kaum sein: Man wünscht sich „Frohe Festtage“, erhält Karten mit „Seasonal greetings“, doch auf der Sondermarke der Deutschen Post steht im selben Jahr 2023 unverdrossen biblisch, „Euch ist heute der Heiland geboren“. So laute die „Botschaft des Engels“. Selbiger ist auf der Zuschlagsmarke zu sehen, mit zwei riesigen weißen Flügeln, wie er mit seiner nach unten gereckten Rechten zu einem Hirten auf der Anhöhe zeigt nebst Stab und Lamm. Was würde Gilbert Keith Chesterton zu einer solchen Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen sagen?
Jahr um Jahr versuchte der 1936 gestorbene englische Schriftsteller den „Geist der Weihnacht“ zu ergründen. In seinem letzten Text hierzu schrieb er: „Wir haben Schritt für Schritt, im majestätischen Marsch des Fortschritts, zuerst Weihnachten zu etwas Vulgären gemacht und es dann als vulgär angeprangert.“ Hitler verglich er mit dem in der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus verbürgten König Herodes, der Kleinkinder ermorden ließ, damit die Botschaft des Engels nicht wahr werden konnte.
Herodes scheiterte. Weihnachten kam in die Welt und ist aus dieser bis zu ihrem Ende und weit über Hitler und Konsorten hinaus nicht fortzudenken. Die von Chesterton beklagten „Angriffe gegen Heim und Herd und gegen die Menschheitsfamilie“ werden nicht triumphieren.
Warum ist das so? Woher rühren die Attacken auf Weihnachten, das heute in seiner materiellen wie seiner geistigen Substanz unter die Räder zu kommen droht? Weihnachten ist als geweihte Nacht in erster Linie ein religiöses, ein spezifisch christliches Ereignis. Das missfällt vielen modernen Christen. Sie meinen, angefeuert von traditionsallergischen Kirchenvertretern, bei Weihnachten handele es sich um ein humanistisches Hochamt – eine Einladung von Menschen an Menschen, doch bitte ganz doll lieb zueinander zu sein. So habe es das Kind in der Krippe gewollt.
Chesterton entgegnet solchen Umdeutungsversuchen, Wurzeln hätten „einen Vorteil, und sein Name ist Frucht“. Steril wird jede Feier, jede Erinnerung, versichert sie sich nicht immer wieder ihres Grundes. Weihnachten ist stets neu, weil da immer wieder ein Schrei in der „Höhle von Bethlehem“ die Menschen zur Vernunft, zur Hoffnung und – ja, auch das – zum Glauben rufen will. „Der Mensch, der nichts von neuem beginnt, der wird nichts Bedeutendes leisten“, und darum steht ein tumber Traditionalismus Weihnachten ebenso entgegen wie jene Fortschrittlichkeit, die sich ihre Bildungslücken als Erkenntnis anrechnet.
Eben dieser Trend hat längst Bischofssitze und Pfarrhäuser erobert. Da faselt das geweihte Personal von der Augenhöhe Gottes mit den Menschen, von den Abgründen des Kapitalismus und der korrekten Weise, Politik zu treiben und Regierungen zu wählen, und merkt nicht, wie fade, wie feige solche Predigt geworden ist. Sie erhebt das Herz nicht, erbaut die Seele nicht, erfreut nicht, tröstet nicht, lehrt nicht. Da herrscht das Einheitsgrau des handelsüblichen Floskeltums – und zeitigt gerechte Ergebnisse.
Eine Umfrage ergab, dass in Deutschland immer weniger Menschen Weihnachtsgottesdienste besuchen wollen. Auch wachsen die Austritte stabil. So ernten die Kirchen, was sie säten: den getauften Glaubenslegastheniker. Wer seit Jahr- und Jahrzehnten Säkularismus predigt, darf sich auf die Schulter klopfen. Zumindest diese Mission wurde erfüllt.
Neben solcher spirituellen Selbstaustreibung gibt es feindliche Angriffe der brutalen Art. Krippen werden ebenso geschändet wie Kirchen, ein Weihnachtsmann wurde jüngst verprügelt, ein neuerlicher Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verhindert. „Die Kirche“, so Chesterton, habe „gewiss nie all die Aufzeichnungen über alte Götter hinweggefegt, so wie Mohammed die alten Götzenbilder hinwegfegte.“
Fanatisierte Muslime nehmen in ihrer verkehrten Vernichtungsgier den christlichen Kern des Weihnachtsfestes tödlich ernst: dass da einst Gott in der Gestalt eines Menschenkindes auf die Erde gestiegen und damit das letzte Wort über Mensch, Welt und Gott gesprochen worden sei.
Als Unglaube erscheint den einen, als Fehlglaube den anderen Verächtern des Weihnachtsfestes, was jedes Jahr an „Heim und Herd“ gefeiert wird. Weihnachten ist ein Fest der Häuslichkeit, wusste Chesterton, ist die Feier eines jeweils ganz spezifischen Heimes, das zugleich der Menschheitsfamilie offensteht.
Das einsame Weihnachten ist nicht minder traurig als das entkernte Weihnachten. Niemand muss es feiern, niemanden müssen die christlichen Wahrheiten überzeugen. Wer sich aber auf Weihnachten beruft, sollte auch von Weihnachten sprechen, vom angreifbaren Gott, und nicht von den eigenen Befindlichkeiten oder der eigenen politischen Agenda. Das instrumentalisierte ist das erdrosselte Weihnachten, die politisierte die leere Kirche.
Der tiefste Grund, warum Weihnachten ein Skandal ist und weshalb es heute auf derart schwache Verteidiger und derart brachiale Feinde stösst, liegt an einer ganz anderer Stelle – und auch sie suchte Chesterton auf: Der „Geist der Freiheit“ werde an Weihnachten zelebriert, paradoxerweise „hinter verschlossenen Toren, hinter geschlossenen Fensterläden, hinter Türen, dreifach verrammelt und verriegelt.“ Die Einladung zur Freude über die Inkarnation, über die Idee also, „eine gute Absicht selbst zu verkörpern“, kann nur in Freiheit ausgesprochen, angenommen oder abgelehnt werden. Und ohne die Freiheit des menschlichen Willens hätte die Menschwerdung von Bethlehem sich nicht ereignet.
Insofern trifft die freiheitsfreundliche Botschaft von Weihnachten in freiheitsskeptischen Zeiten natürlich auf Gegenwehr. Wahr aber ist auch: „Nur die Dinge, die niemals sterben, werden totgesagt.“ Frohe Weihnachten!