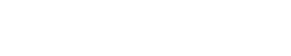Der Heizer von Zürich
Er war der Heizer von Zürich. Er hielt das Schiff auf Kurs, den Laden am Laufen. Der Schweiß, der ihm die Backen benetzte, die Augen verklebte, war sein Manna. Er schuf es sich selbst, indem er schuftete, jeden Tag, tief unten im Bauch des Schiffes, wo kein Licht zu sehen, kein Fenster zu finden war.
Die immer gleichen Bewegungen führten ihn in der immer gleichen Weise in seinem Käfig herum, sechs Schritte nach rechts, fünf nach links, er wurde überall gebraucht. Seine Hände waren Pranken, in denen kein Glas je zerbrach. Seine Augen waren pechschwarze Kiesel, denen kein Wink entging.
Um ihn wogten die Gestalten, wankten herbei und perlten rasch davon, die er durch sein Tun zum Leben erweckt hatte. Konnte etwas entstehen ohne ihn, ohne seinen harten Griff in den breiten Nacken, der spannte, ohne das immer wieder kurze Rucken des Schädels zur Seite, den Griff des Fleisches nach dem Fleische, wenn er die Flaschen öffnete, die Tassen füllte, die Münzen wog und warf? Über ihm schwoll das Tirilieren an zum schrillen Chor und erblühte im stumpfen, dumpfen Schlagen hier unten, wo von den Tönen nur der Rhythmus blieb, sein Rhythmus, er hatte ihn gemacht.
Manchmal, wenn die Gestalten ihn schonten, weil sie oben saßen bei den Melodien, packte er das allerkleinste Glas am Henkel, füllte es mit einem scharfen Wasser und schüttete es hinunter. Die Brauen zog er dann zusammen, sodass kein Auge mehr da war. Oben, ja oben, suchte Papageno sein Mädchen, war Falstaff wieder betrunken, fand Karlos einen trüben Tod, mordete Macbeth und schmiedete Hagen finstere Pläne.
Er kannte sie, die Abgründe der Seele, die hier unten ein Wimmern waren, ein Wummern, ein Pochen in den Eingeweiden des Schiffs, das er befehligte. Mehr brauchte man vom Leben nicht zu wissen und seinen Verwicklungen. Kein Kapitän ohne Heizer, keine Hitze ohne Kohlen, und die Kohlen waren sein Geschäft: Das wusste er genau, das machte ihn manchmal lachen. Der Treibstoff der Leidenschaft rann durch sein Fleisch, damit sie dort oben zur Form gerinnen konnte. Ohne ihn wären sie Schemen geblieben, die Damen und Herren mit den offenen Mündern und den hohen, spitzen, tiefen Tönen, Schatten ohne ihn.
Er war der erste, der kam, der letzte, der ging. Er rief das Leben ins Leben, wenn er die Stufen hinab schritt zum Gehäuse im Keller. War sein Leib ein Hort den Schlüsseln, mit denen alles hier begann, Abend um Abend und sonntags viel eher? Er war Mittelpunkt der Schänke, um ihn zischte und brodelte und knallte es, ruhig blieb er.
Der harte Klang trug die Stimme eines Fremden, jenseits der Alpen stand seine Wiege. Wann war das gewesen, ehedem? Nun war er eins geworden mit den Gerüchen, die er anzog, die er ausdünstete noch in der Nacht, mit Kaffee und Wein und Amber und Weihrauch und Orange. Er schwitzte sie aus und nahm sie auf, im ewigen Kreislauf des Heizens, in den Pausen und davor und dazwischen, während und ehe ein Maestro den Stab hob und das Blech befreite, dort oben. So sah ich ihn oft.
Nun bin ich wieder dort gewesen. Das Schiff steht noch am selben Ort, das Gehäuse im Keller aber ist kein Maschinenraum mehr. Jetzt drängelt sich dort Fachpersonal vom Cateringservice, junge Frauen, junge Männer, gertenschlank allesamt, drei Trippelschritte nach rechts, zwei nach links. Wenn die Gestalten schweben dort oben, dösen sie hier, drehen das Haar zwischen hageren Fingern. Was ist aus dem Heizer geworden? Wer weicht dem Eisberg nun aus? Jeder Heizer trägt ein Polarmeer in sich.