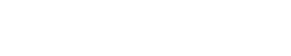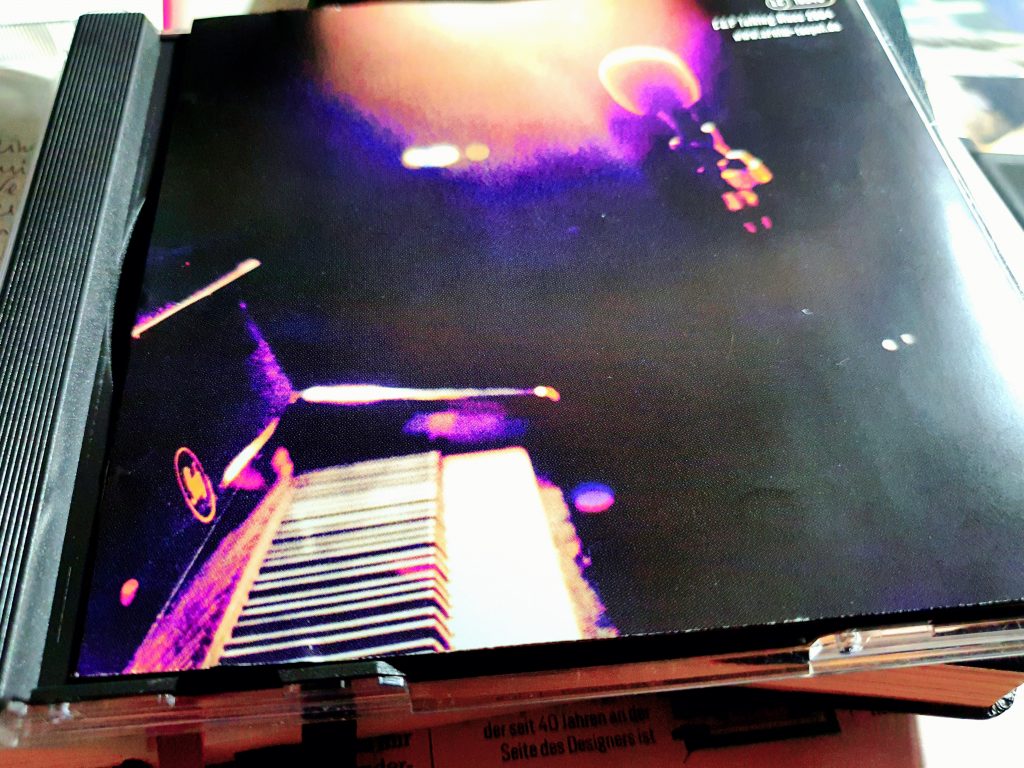Das Denkmal, der Hass und Bismarcks Tränen
Nikolsburg – sagt das noch jemandem etwas? Die Stadt heißt heute Mikulov und liegt in der Tschechischen Republik. Als sie noch Nikolsburg hieß, war sie Teil des Habsburgerreiches. In Nikolsburg wurde am 28. Juli 1866 mit einem Vorfrieden der Grundstock gelegt für den Friedensvertrag zwischen dem siegreichen Preußen und dem unterlegenen Österreich. Im Nikolsburger Schloss weinte Otto von Bismarck. So schreibt es der gewesene preußische Reichskanzler in seinen Erinnerungen. König Wilhelm I. nämlich schien Bismarcks Rat in den Wind zu schlagen und sich der „militärischen Mehrheit“ anzuschließen. Bismarck drang auf Friede und Verständigung – zunächst erfolglos: „Ich stand schweigend auf, ging in mein anstoßendes Schlafzimmer und wurde dort von einem heftigen Weinkrampf befallen.“

Ob Bismarck wirklich geweint hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er am nächsten Tag wirklich „in der Stimmung“ war, „dass mir der Gedanke nahe trat, ob es nicht besser sei, aus dem offenstehenden, vier Stock hohen Fenster zu fallen“. Auch das steht in den „Gedanken und Erinnerungen“ von 1890. Heute hätte Bismarck allen Grund zu düsteren Gedanken. Gerade wurde sein Denkmal im Hamburger Schleepark mit roter Farbe beworfen. Gerade wird diskutiert, ob und falls ja, in welcher Weise, Bismarck-Denkmäler stehen bleiben sollen. Es gibt deren rund 700 in Deutschland. Auch anderen Heroen der Vergangenheit soll es an den Kragen gehen. Der eine, heißt es, sei Nationalist gewesen, der andere Rassist, ein Dritter habe sich auf unerträgliche Weise zu Frauen geäußert. Denkmäler können sich nicht wehren. Sie stehen stumm und schweigen.
Umso lauter wird der Furor der Aktivisten. In vielen Ländern des Westens wollen sie den öffentlichen Raum säubern von Zumutungen, denen sie nicht standhalten wollen. Allem Hass gereicht zum Vorteil, was sonst Nachteil ist: Unbildung. Darum wächst er epidemisch. Die militante Geste, das Hinwegräumen und Abservieren des Überkommenen, braucht keinen Gedanken, keinen Diskurs, kein Argument. Weg soll für alle, was einige stört. Die Radauelite entscheidet stellvertretend für eine Mehrheit, um die sie sich nicht bemüht. Eine größere Misstrauenserklärung an die Zeitgenossen ist nicht denkbar als die Unterstellung, jene könnten das Vergangene nicht vom Gegenwärtigen trennen; als die Unterstellung, jeder nähere sich einem Denkmal auf Knien, weil er falsch denke, blind blicke. Der dumme Mensch ist der Normalfall in den Augen derer, die sein Sichtfeld reinigen wollen.
Der Mensch misstraut sich selbst, will es nicht eingestehen und macht die eigene Unvernunft den anderen zum Vorwurf: So lautet der bewusstseinspolitische Status quo des Jahres 2020, nicht nur, aber besonders auf der Linken. Das Ende der Diskurse wird ausgerufen, weil die Mühe des Nachdenkens auch eigene Anstrengung bedeutete. Abweichende Meinungen werden als moralische Defekte gebrandmarkt, weil die eigene Meinung auf instabilen Füßen ruht. Ein Kulturkampf ohne Kultur findet statt, eine Abbau ohne Aufbau, ein stehendes Meinungsgericht. Nicht nach Gründen wird gefragt, sondern nach Motiven; nicht Rechte sollen hergestellt, sondern Exempel statuiert werden. Odo Marquard befürchtete schon vor über 30 Jahren die Tribunalisierung der Wirklichkeit, wenn das „Rechtfertigungsverlangen“ ubiquitär werde, es in alle Ritzen dringe. Heute lautet die Parole: Rechtfertige dich oder stimme uns zu!
Hass auf die Vergangenheit ist wie jeder Hass eine dumme Sache. Ohne jeden Zweifel darf und muss in einer offenen Gesellschaft diskutiert werden, ob dieser oder jener Altvorderer heute noch auf einen Sockel gehört. Ich selbst bin alles andere als ein Bismarckianer und auch sofort bereit zuzugestehen, dass der belgische König Leopold II. buchstäblich Blut an den Fingern hatte. Es gibt keinen Grund, ihm im nationalen Pantheon zu salutieren. Öffentliche Akte des Hasses aber sind immer gegen die Republik gerichtet, da sie Selbstermächtigung an die Stelle von Partizipation setzen. Sie nehmen den Ausgang einer Diskussion vorweg, deren Anfang sie verhindern. Es sind totalitäre Selbstauskünfte, die keinen Demokraten kalt lassen dürfen. Gegen Abgründe ist ein anderes Kraut gewachsen: das aufklärende Gespräch, die Selbstvergewisserung einer Gesellschaft. Wir nannten es Bildung.
Die Befürchtung ist nicht von der Hand zu weisen, im neuen Bildersturm tobe sich die Wut nicht nur auf besonders ambivalente Figuren aus, sondern auf die gesamte Vergangenheit. Schwinden soll, was an alte Zeiten erinnert, das Meiste zumindest. Und warum? Zum Einen, wie gesagt, weil Vergangenheit nur versteht, wer sie durchdringt; diesen Aufwand scheuen Aktivisten gern. Zum Anderen, weil Gilbert Keith Chesterton – kennt ihn noch jemand? – uns noch immer durchschaut. Chesterton schrieb 1920, das moderne Denken sei „durch ein Gefühl der Müdigkeit“ und durch „die Angst vor dem Vergangenen“ gekennzeichnet, „eine Angst nicht nur vor dem Schlechten in der Vergangenheit, sondern auch vor dem Guten, das in ihr lag.“ Nur die Zukunft sei „eine leere Wand, auf die jeder seinen Namen schreiben kann, so groß er will. Die Vergangenheit finde ich schon mit unentzifferbarem Gekritzel bedeckt, wie Plato, Jesaias, Shakespeare, Michelangelo, Napoleon. Die Zukunft kann ich so eng werden lassen wie mein eigenes Selbst; die Vergangenheit muss so weit und mannigfach bleiben wie die ganze Menschheit.“
Damit dürfte der tiefere Grund für die neue Lust der Bilderstürmerei gefunden sein: Eine Tabula Rasa wollen die Rasenden errichten, um sich selbst unvergleichlich genießen zu können. Wer vor keinem Maßstab besteht, kämpft gegen Maßstäbe an. So kriecht einmal mehr aus der stärksten Überzeugung das kleinste Ich hervor.