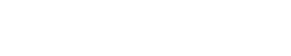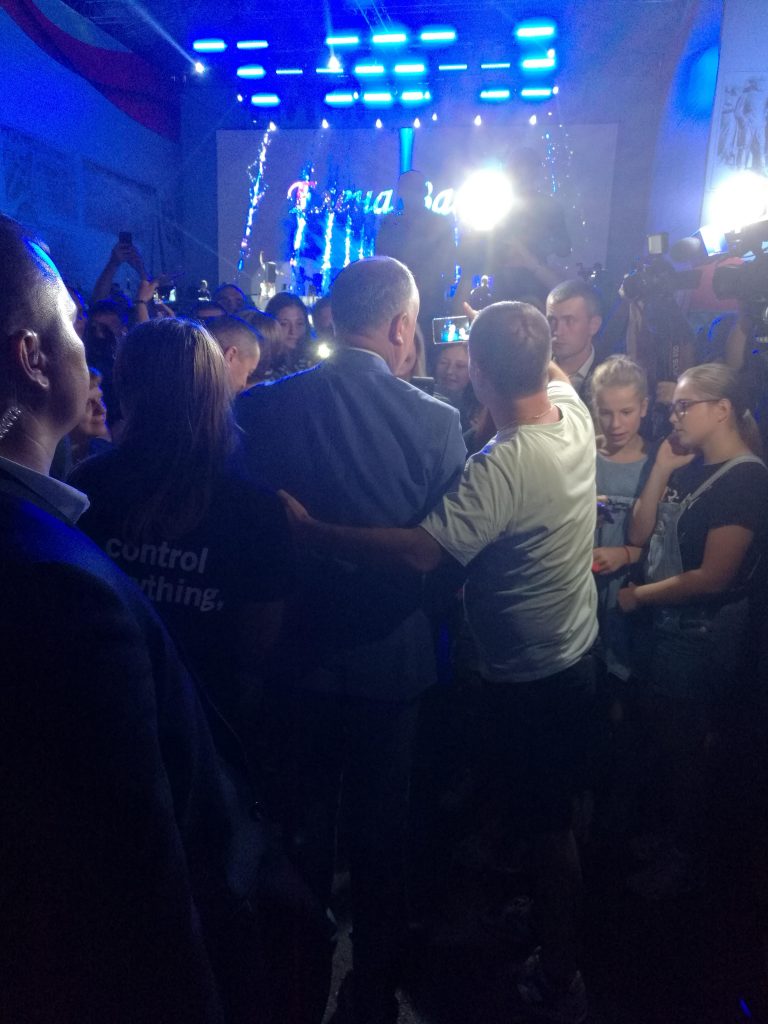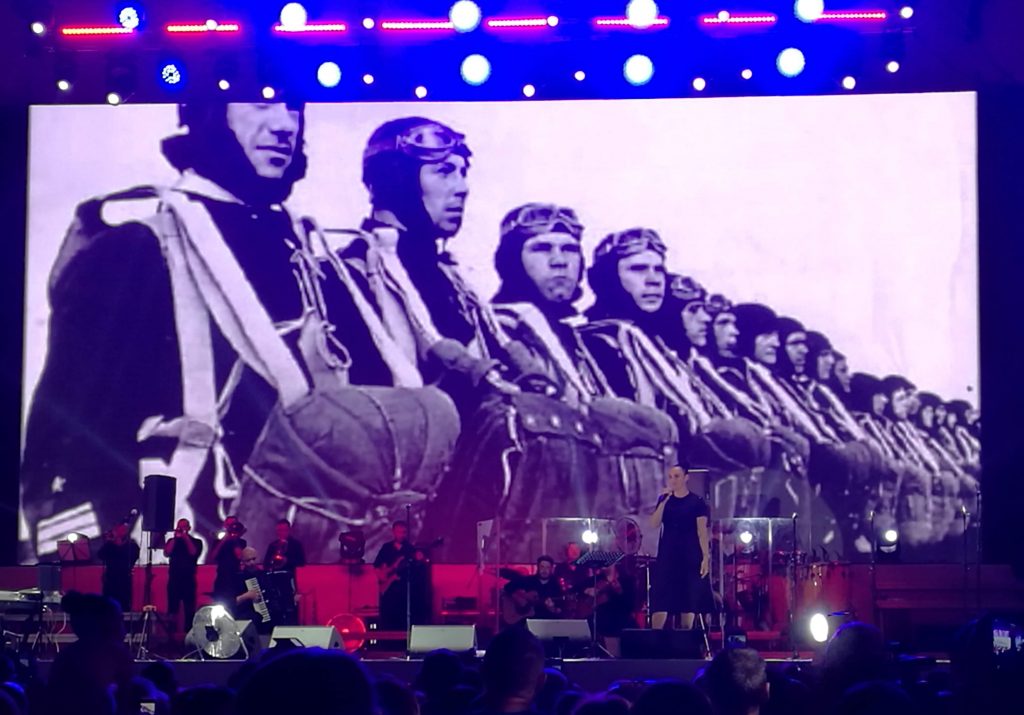Deutschland, Joe Kaeser und entführte Hirne
Kann man Hirne entführen? Daran und an Richard Dawkins musste ich denken, als ich las, was man so liest in diesen Tagen. Mullah-Versteher hatten ihren Auftritt und bekamen ihre Sendezeit, Mietendeckelverfechter, Buschbranddeuter, Strompreiserhöhungsfans und Enteignungsbefürworterinnen. Und dann war da noch das platonische Werben eines Münchner Dax-Vorstands um ein Jungmitglied der Grünen; sie, die Umworbene, Neubauer mit Nachnamen, als #Langstreckenluisa zu bitterem Netzwerkruhm gelangt, lehnte ab. Sie sei, stand zu lesen, damit ausgelastet, die Welt zu retten. „Irgendwelche Aufsichtsratsgeschichten“ stören da. Pech für Josef, genannt Joe, Kaeser, den Top-Arbeitnehmer der Siemens AG.

Richard Dawkins kam mir in den Sinn, weil ich dessen Werke vom „Egoistischen Gen“ und vom „Gotteswahn“ konsultierte, als ich 2008 mein Buch über den „Aufgeklärten Gott“ schrieb. Dawkins sah ich unter den vielen Neoatheisten der damaligen Zeit am kritischsten. Das lag neben seiner zynischen Weise, in der er über Gläubige sprach, an Dawkinsʼ Kernthese: Der Glaube kapere die Hirne der Menschen – der Kinder vor allem. Dawkins wollte biologisch begründen, was er intellektuell nicht aus der Welt bekam. Dem Glauben verlieh er eine materielle Basis, erklärte ihn zum „Mem“ oder zum „geistigen Virus“. So beging er in meinen Augen einen schlimmen Kategorienfehler. Geist und Materie – Schiller sprach rund 200 Jahre früher vom Stoff- und vom Formtrieb – vermengte er. Als ließen sich Gedanken wiegen, Träume fotografieren, Hoffnungen messen. Das geht nicht.
Vielleicht muss ich Abbitte leisten. Zumindest ein wenig. Ich blättere in meinem „Aufgeklärten Gott“, durchstöbere den „Gotteswahn“ und finde die Formulierung von den entführten Hirnen nicht. Vielleicht schob ich mit dieser Prägung verschiedene Lektüren zusammen. Dennoch scheint es mir ein sinnvoller Ausdruck. Zumal ich bei Dawkins lese: „Anthropologische Übersichtsdarstellungen (…) machen deutlich, dass es unter den Menschen eine beeindruckende Vielfalt irrationaler Überzeugungen gibt. Einmal in einer Kultur verwurzelt, können sie sich halten, weiterentwickeln und immer vielgestaltiger werden – ein Vorgang, der stark an die biologische Evolution erinnert.“ Außerdem: „Unter anderem will ich damit sagen, dass es keine Rolle spielt, welche besondere Form von Unsinn das Kindergehirn befällt. Einmal angesteckt, wächst das Kind auf und infiziert die nächste Generation mit dem gleichen Unsinn, wie er auch aussehen mag.“
Wie gesagt, Dawkins meinte mit „irrationalen Überzeugungen“ und „Unsinn“ religiöse Gebote und theologische Dogmen. Sie stehen nach seiner Auffassung der Entwicklung des Menschen zur Mündigkeit entgegen, pflanzen sich aber dennoch fort. Das ärgert den Evolutionsbiologen, weshalb er sich die Weitergabe der Religion als biologischen Vorgang denkt. Das Gehirn, ließe sich mit Dawkins sagen, wird von Kindesbeinen an deformiert, sodass ihm später Unsinn als sinnvoll erscheint. Es kann ihn gar nicht mehr hinterfragen. Das Gehirn bleibt – in meinen Worten – entführt.
Stellen wir uns kurz vor, Richard Dawkins hätte Recht – gerade progressive, linke Köpfe nicken da schneller, als es dieser These und ihrem eigenen Hirn guttut. Aber stellen wir uns das wirklich einmal versuchshalber vor: Es gäbe ganz handfeste, stoffliche Komplexe von Ideen und Vorstellungen, die dem Gehirn eingeschrieben wurden. Und dass uns (oder vielen oder manchen) die materiellen Möglichkeiten fehlten, sie zu korrigieren. Dass wir (oder viele oder manche) in einem Wahn gefangen sind, der als Ausdruck von Vernunft erscheint, weil das Gehirn so programmiert wurde. Dawkins öffnet die Spur, wenn er ausdrücklich vom „Unsinn, wie er auch aussehen mag“, schreibt. Wie schaut er heute aus, der Unsinn?
Damit wären wir bei den Schlagzeilen gelandet, bei Mullah-Verstehern, Mietendeckelverfechtern, Buschbranddeutern, Strompreiserhöhungsfans, Enteignungsbefürworterinnen und einem Vorstandsvorsitzenden auf Haltungsbrautschau. So unterschiedlich die Schlagzeilen sein mögen, dahinter verbirgt sich eine quasireligiöse Weltanschauung von enormer Bindekraft. Die neuen Dogmen lauten: Der Westen hat sich blamiert, die USA sind böse, der Kapitalismus ist gescheitert. Der Staat muss Gerechtigkeit verordnen, Privateigentum ist Diebstahl, Klimanot kennt kein Gebot. Wie bei allen Dogmen gibt es Abstufungen in der Art, wie man sie praktisch ernst nimmt. Wer sie aber grundsätzlich bezweifelt, trifft auf das geballte Gegenfeuer entführter Gehirne – um im Sprachbild zu bleiben.
Die neuen Dogmen sind legitime Meinungsäußerungen. Mehr nicht. Die jeweilige Gegenmeinung ist und wäre auch legitim. Das pauschale Unverständnis, auf das ein Kontra oft stößt, lässt Dawkins für einen Augenblick plausibel erscheinen. Es scheint, als fehlte an zu vielen Stellen unserer Gesellschaft, unserer Politik, unserer Wirtschaft nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit, Gedanken mit Gedanken zu beantworten. Als mangelte es an der nötigen Voraussetzung, auf Kritik schöpferisch zu reagieren. Als herrschte eine Generation, die in behüteter Fraglosigkeit aufwuchs und sich darum alles Fragen verbittet. Als wäre Moral die Bringschuld der anderen, während man selbst sie unkündbar gepachtet habe.
Zu vieles versteht sich von selbst und wird darum missverstanden. Zu wenig wird hinterfragt, weil Fragen als Moralvergehen gilt. Zu viele wissen Bescheid, zu wenige haben Ahnung. Zu selten wird argumentiert, zu oft verdammt. Wir leben in keiner Gesellschaft der Echokammern. Wir leben in einer Welt, in der Echos unerwünscht sind. Unterscheidung der Geister, Befreiung des Geistes: das sollte Gebot der Stunde sein.