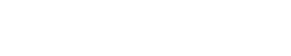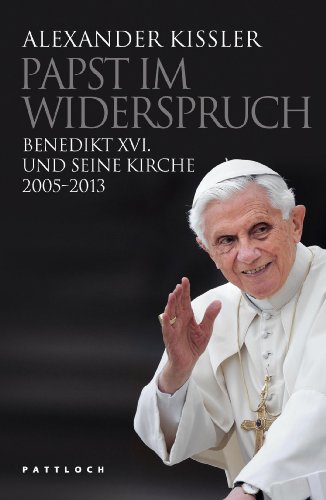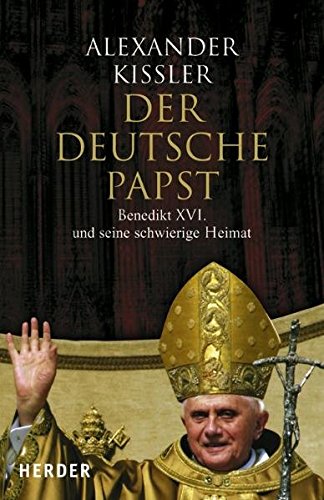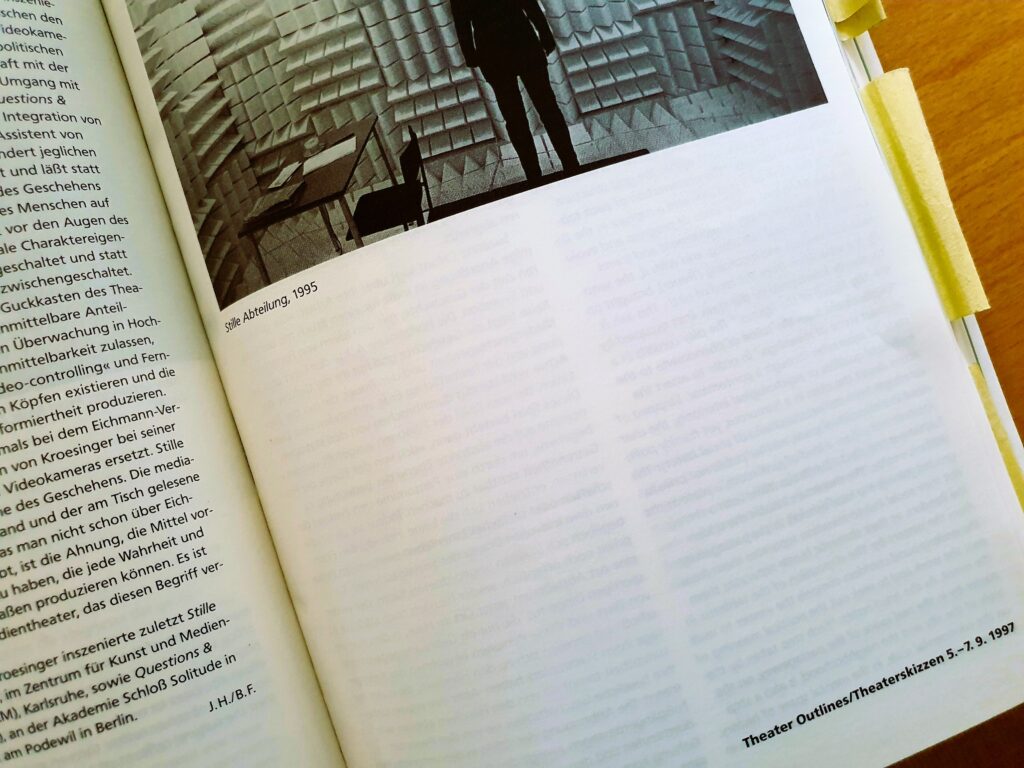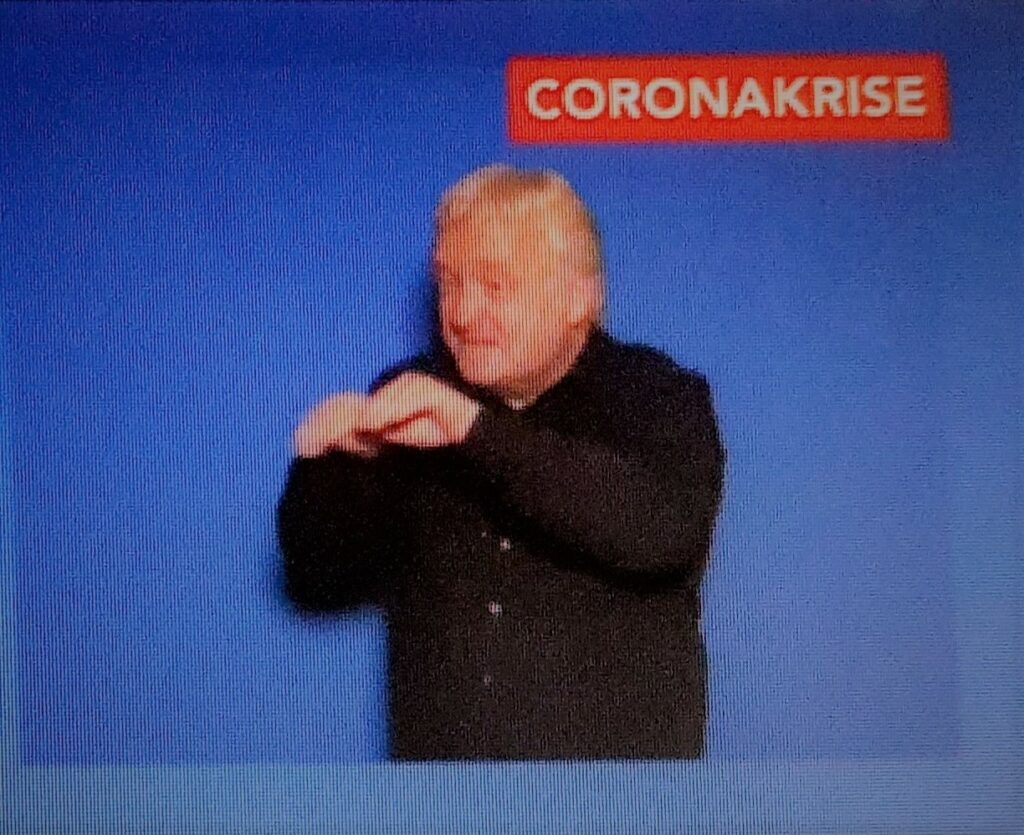Eier sind wirklich Eier – und Rosen Rosen

Die Zeiten sind in Verwirrung, die Probleme türmen sich zum Himmel, die Gesellschaft gerät aus der Balance – wer wollte es bestreiten? Da tut es gut, sich für einen Augenblick an die „Philosophie des gesunden Menschenverstandes“ zu erinnern, wie sie Thomas von Aquin vertrat.
Zumindest deutet Gilbert Keith Chesterton den großen Abendländer so. In seiner hinreißenden Biografie „Der stumme Ochse“ (1933/35), die natürlich auch eine Selbstbeschreibung ist, entdeckt Chesterton den Aquinaten als Bruder im Geist. Die Punkte, die die beiden klugen Köpfe verbinden, sind jene, die im Jahre 2024 wie eine Flaschenpost für uns Heutige erscheinen. Denn was, folgen wir Chesterton, lässt sich beim Aquinaten lernen? Viererlei, scheint mir.
Erstens sollte der Mensch nie aufhören, neugierig zu sein, auf andere, auf sich, auf das, was er ablehnt, was ihm nicht einleuchtet, was ihn herausfordert. Thomas, schreibt Chesterton, „arbeitete die Schriften selbst von Gegnern des Christentums viel sorgfältiger und unbefangener ab, als es zu seiner Zeit üblich war.“ Echokammern und Blasengespräche wären mit ihm nicht zu machen. Wer die Welt verstehen will, der muss sich für sie in all ihren Schattierungen interessieren. Thomas war nämlich „durchaus kein Mensch, der gar nichts wollte, sondern ein Mensch, der sich ganz außerordentlich für alles interessierte.“ Wer nichts will, wird nie etwas erreichen.
Zweitens blieb es, Chesterton zufolge, nicht beim bloßen Spiel der Reize und Gegenreize. Thomas war überzeugt: Die Welt ist dazu da, dass wir etwas von ihr lernen. Er vertraute der Vernunft. Dieses Vertrauen, ohne das sich kein Problem lösen lässt, droht heute verloren zu gehen.
Drittens erhielt bei Thomas der „unverbogene Geist des einfachen Menschen“ deshalb philosophische Weihen, weil der Bettelmönch von der Erkennbarkeit der Welt überzeugt war. Chesterton bringt es auf eine klassisch gewordene Formel: „Die Philosophie des hl. Thomas steht auf dem normalen Standpunkt, dass Eier wirklich Eier sind.“ Es sind nicht eihafte Ideen, nicht Hühner als „Teil eines endlosen Werdeprozesses“, nicht Träume, nicht Vorprodukte von Spiegel- oder Rühreiern.
Chesterton urteilt hart: „Seitdem im 16. Jahrhundert die Neuzeit begonnen hat, steht kein einziges philosophisches Weltbild mehr wahrhaft im Zusammenhang mit der Anschauung irgendeines Menschen von der Wirklichkeit – mit dem, was der gewöhnliche Mensch, wenn man ihn sich selbst überließe, den gesunden Menschenverstand nennen würde.“ Heute, denke ich, kommt es in der Politik auf die Rückgewinnung der Wirklichkeit und die Rückkehr zum gesunden Menschenverstand an.
Was nämlich ist – viertens – das Resultat, wenn der Mensch neugierig bleibt, der Vernunft vertraut und die Wirklichkeit als wirklich annimmt? „Das einzig wirklich zutreffende Wort für seine Atmosphäre ist Optimismus.“ Wir leben in zuweilen düsterer Zeit, weil ohne Vernunft, Neugier und Realismus nur Dogmen bleiben, und keine Hoffnung, kein Optimismus mehr gedeiht. Wären wir bereit, von Chesterton und Thomas zu lernen?